
Viele der Kinder, welche wir in unseren Arbeitskontexten antreffen, haben in ihrem noch jungen Leben bereits sehr widersprüchliche, oft verunsichernde und ängstigende Beziehungserfahrungen gemacht. Leiden die Eltern an psychischen Erkrankungen, erleben ihre Kinder sie oft als hilflos, emotional nicht zugänglich und unberechenbar. Manche schämen sich für ihre Eltern, sie können das elterliche Verhalten nicht einordnen, ihre Bedürfnisse werden unzureichend berücksichtigt. Das bedeutet, dass die betroffenen Kinder mit ihrem Erleben immer wieder auf sich alleine gestellt sind und keine Unterstützung in ihrer Not erhalten.
Fast allen Kindern und Jugendlichen, welche kurzzeitig in der Krisenwohngruppe untergebracht sind, war es vergönnt, in ihren ersten Lebensjahren einigermassen stabile Beziehungen zu erleben, in welchen sie haltgebende Bindungserfahrungen machen konnten. Viele sind sehr verunsichert, zeigen bisweilen irritierende oder auch (selbst)zerstörerische Verhaltensweisen. Oft ist es nicht einfach, sie zu verstehen und ihr Verhalten richtig zu interpretieren und einzuordnen. Man läuft Gefahr, sich in der Interaktion fehlleiten zu lassen und bisherige Beziehungserfahrungen zu wiederholen.
Eine stärkere Fokussierung auf die primären Bindungserfahrungen dieser Kinder und Jugendlichen ermöglicht es, die irritierenden Verhaltensweisen als überlebenswichtige Anpassungsleistung zu erkennen und entsprechend auch pädagogische Interventionen abzuleiten.
Dieser Workshop fokussiert einerseits auf das Erleben und vor allem die Unterstützung von Kindern psychisch kranker Eltern, andererseits auf Methoden und Instrumente, welche dabei unterstützen, sie vor dem Hintergrund ihrer Lebensgeschichte zu verstehen und dadurch neue Beziehungserfahrungen zu ermöglichen.
Viele der Kinder, welche wir in unseren Arbeitskontexten antreffen, haben in ihrem noch jungen Leben bereits sehr widersprüchliche, oft verunsichernde und ängstigende Beziehungserfahrungen gemacht. Leiden die Eltern an psychischen Erkrankungen, erleben ihre Kinder sie oft als hilflos, emotional nicht zugänglich und unberechenbar. Manche schämen sich für ihre Eltern, sie können das elterliche Verhalten nicht einordnen, ihre Bedürfnisse werden unzureichend berücksichtigt. Das bedeutet, dass die betroffenen Kinder mit ihrem Erleben immer wieder auf sich alleine gestellt sind und keine Unterstützung in ihrer Not erhalten.
Fast allen Kindern und Jugendlichen, welche kurzzeitig in der Krisenwohngruppe untergebracht sind, war es vergönnt, in ihren ersten Lebensjahren einigermassen stabile Beziehungen zu erleben, in welchen sie haltgebende Bindungserfahrungen machen konnten. Viele sind sehr verunsichert, zeigen bisweilen irritierende oder auch (selbst)zerstörerische Verhaltensweisen. Oft ist es nicht einfach, sie zu verstehen und ihr Verhalten richtig zu interpretieren und einzuordnen. Man läuft Gefahr, sich in der Interaktion fehlleiten zu lassen und bisherige Beziehungserfahrungen zu wiederholen.
Eine stärkere Fokussierung auf die primären Bindungserfahrungen dieser Kinder und Jugendlichen ermöglicht es, die irritierenden Verhaltensweisen als überlebenswichtige Anpassungsleistung zu erkennen und entsprechend auch pädagogische Interventionen abzuleiten.
Dieser Workshop fokussiert einerseits auf das Erleben und vor allem die Unterstützung von Kindern psychisch kranker Eltern, andererseits auf Methoden und Instrumente, welche dabei unterstützen, sie vor dem Hintergrund ihrer Lebensgeschichte zu verstehen und dadurch neue Beziehungserfahrungen zu ermöglichen.
Viele der Kinder, welche wir in unseren Arbeitskontexten antreffen, haben in ihrem noch jungen Leben bereits sehr widersprüchliche, oft verunsichernde und ängstigende Beziehungserfahrungen gemacht. Leiden die Eltern an psychischen Erkrankungen, erleben ihre Kinder sie oft als hilflos, emotional nicht zugänglich und unberechenbar. Manche schämen sich für ihre Eltern, sie können das elterliche Verhalten nicht einordnen, ihre Bedürfnisse werden unzureichend berücksichtigt. Das bedeutet, dass die betroffenen Kinder mit ihrem Erleben immer wieder auf sich alleine gestellt sind und keine Unterstützung in ihrer Not erhalten.
Fast allen Kindern und Jugendlichen, welche kurzzeitig in der Krisenwohngruppe untergebracht sind, war es vergönnt, in ihren ersten Lebensjahren einigermassen stabile Beziehungen zu erleben, in welchen sie haltgebende Bindungserfahrungen machen konnten. Viele sind sehr verunsichert, zeigen bisweilen irritierende oder auch (selbst)zerstörerische Verhaltensweisen. Oft ist es nicht einfach, sie zu verstehen und ihr Verhalten richtig zu interpretieren und einzuordnen. Man läuft Gefahr, sich in der Interaktion fehlleiten zu lassen und bisherige Beziehungserfahrungen zu wiederholen.
Eine stärkere Fokussierung auf die primären Bindungserfahrungen dieser Kinder und Jugendlichen ermöglicht es, die irritierenden Verhaltensweisen als überlebenswichtige Anpassungsleistung zu erkennen und entsprechend auch pädagogische Interventionen abzuleiten.
Dieser Workshop fokussiert einerseits auf das Erleben und vor allem die Unterstützung von Kindern psychisch kranker Eltern, andererseits auf Methoden und Instrumente, welche dabei unterstützen, sie vor dem Hintergrund ihrer Lebensgeschichte zu verstehen und dadurch neue Beziehungserfahrungen zu ermöglichen.
Rassismus, Diskriminierung und gesellschaftliche Ungleichheit sind tief in sozialen Strukturen verankert und haben weitreichende Auswirkungen auf die psychische Gesundheit betroffener Menschen. Traumatisierungen entstehen nicht nur durch individuelle Erlebnisse, sondern auch durch strukturelle Gewalt, soziale Ausschlüsse und Diskriminierungserfahrungen. In der Psychotraumatologie gewinnen intersektionale Perspektiven zunehmend an Bedeutung, da sie die Verwobenheit verschiedener Diskriminierungsformen sowie ihre traumatisierenden Effekte und psychischen Folgen in den Blick nehmen.
Wie beeinflussen strukturelle und interpersonelle Diskrimierung die Entstehung und Aufrechterhaltung von Traumafolgestörunen? Welche Rolle spielen gesellschaftliche Machtverhältnisse für die Wahrnehmung und Behandlung von Traumata und ihren psychischen Folgen? Wie kann im therapeutischen Prozess angemessen auf diese Dynamiken eingegangen werden?
Mit dieser Jahrestagung möchten wir die komplexen Zusammenhänge zwischen Diskriminierung, Trauma und gesellschaftlicher Ungleichheit aus einer intersektionalen Perspektive beleuchten. Die Jahrestagung bietet Raum für den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis, um psychotraumatologische Versorgung, Forschung und gesellschaftspolitische Ansätze miteinander zu verknüpfen. Wir laden Sie herzlich ein, diese vielschichtigen Themen im März 2026 in Berlin mit uns zu erkunden und gemeinsam neue Perspektiven zu entwickeln.
Prof. Dr. Maria Böttche
E-Mental Health und Transkulturelle Psychologie
Freie Universität Berlin
Tolou Maslahati
Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin
Charité - Universitätsmedizin Berlin
(alphabetisch angeordnet)
Weitere Informationen folgen in Kürze


Keynote Speaker - Freitag, 20.03.2026, 9.00 - 9.45 Uhr
Diagnostische und psychotherapeutische Annäherungen an rassismusbedingte Stress- und Traumareaktionen
Rassismus stellt in Deutschland ein weit verbreitetes gesellschaftliches Phänomen dar, welches den Alltag von BPoC prägt. Welche psychischen Auswirkungen diese allgegenwärtigen Erfahrungen von Rassismus haben können, ist in Deutschland bislang nur wenig untersucht. Hunderte von Untersuchungen aus dem angloamerikanischen Raum belegen jedoch den Zusammenhang zwischen Rassismuserfahrungen und psychischen Störungen wie Depressionen, Angststörungen und Substanzmissbrauch. Darüber hinaus zeigen Studien Zusammenhänge zwischen Rassismuserfahrungen und PTBS-äquivalenten Stress- und Traumareaktionen, die jedoch aufgrund des Fehlens des A-Kriteriums einer PTBS gemäß DSM-V nicht als PTBS diagnostiziert werden können. Mit der Folge, dass rassismusbedingte Stress- und Traumareaktionen, nicht oder nur unzureichend behandelt werden. Mit Konzepten wie „racial trauma“ oder „race-based traumatic stress injury“ und darauf basierenden Instrumenten können rassismusbedingte Stress- und Traumareaktionen diagnostisch erfasst werden. Neben der Darstellung dieser diagnoserelevanten Reflexionen werden im Vortrag kognitiv-behaviorale Zugänge zur Behandlung rassismusbedingter Stress- und Traumareaktionen vorgestellt.

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Keynote Speaker - Samstag, 21.03.2026, 9.00 - 9.45 Uhr
Reconsidering trauma through the lens of social maltreatment: What does the research say?
Social discrimination and maltreatment (SDM), including racism, sexism, and anti-LGBTQ+ behaviors, is widely prevalent in cultures throughout the world and has been linked to adverse outcomes ranging from depression, social alienation, substance abuse, and suicidality. Yet, there is significant disagreement as to whether SDM can be considered a psychological trauma, with current ICD and DSM trauma definitions generally requiring the presence of very threatening or catastrophic events. As a result, although some SDMs involving physical or sexual assault (e.g., hate crimes) may meet trauma criteria, nonassaultive SDMs (e.g., sexist, homophobic, antisemitic, or racist maltreatment; shaming for one’s gender minority status) are not viewed as traumatic and cannot serve as the basis for a stress disorder diagnosis. Yet, a growing body of research indicates that SDMs can be a major source of trauma for marginalized groups, and can exacerbate the effects of conventional traumas as well as producing DSM/ICD-level posttraumatic stress. This talk will offer an argument in favor of viewing SDM as a potential traumatic stressor, describe the results of two recently published Canadian-American studies indicating that cumulative and intersectional exposure to SDMs is common, often perceived as life-threatening, and at least as related to posttraumatic stress as classically defined trauma exposure, and (4) the clinical and social implications of viewing SDMs as directly traumatizing.
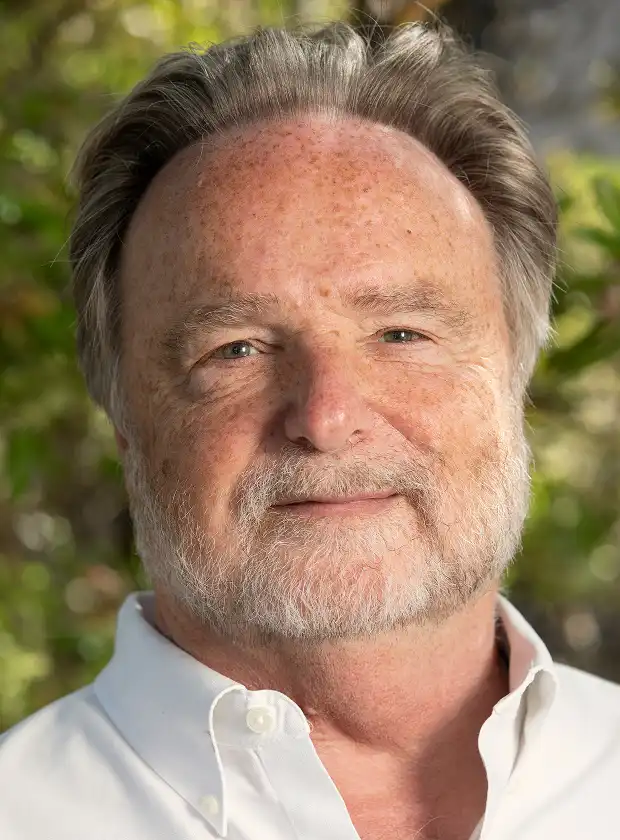
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Keynote Speaker - Freitag, 20.03.2026, 9.45 - 10.30 Uhr
Wie Kinder- und Jugendpsychotherapie rassismussensibel werden kann
Rassistische Diskriminierung stellt für viele Kinder und Jugendliche in Deutschland eine alltägliche Erfahrung dar – mit erheblichen Folgen für ihre psychische Gesundheit. Aktuelle Daten des NaDiRa-Monitorings 2025 zeigen, dass Schwarze, muslimische und asiatische Jugendliche überdurchschnittlich häufig sowohl subtilen wie auch offenen Formen rassistischer Ausgrenzung ausgesetzt sind. Diese Erfahrungen sind kein Randphänomen: Rund ein Drittel der Betroffenen berichtet von moderaten bis schwerwiegenden depressiven Symptomen und Angstsymptomen. Besonders gravierend sind die engen Zusammenhänge mit Suizidalität und nicht-suizidaler Selbstverletzung, die in jüngeren Studien konsistent belegt wurden. Vorgestellt werden erste Ergebnisse einer von der Antidiskrimierungsstelle des Bundes geförderten Studie mit 460 Jugendlichen, die mithilfe partizipativer Verfahren und intensiver Längsschnittmethoden (Ambulatory Assessment) untersucht hat, wie sich Alltagsdiskriminierung auf Belastungs- und Bewältigungsprozesse auswirkt. Zentrales Anliegen ist dabei die Rekonstruktion der subjektiven Perspektiven der Jugendlichen, die über einen Zeitraum von einem Monat täglich ihre Differenz- und Diskriminierungserfahrungen in Kurzessays dokumentiert haben. Erste Befunde deuten darauf hin, dass Diskriminierung nicht nur individuelle Belastungen verstärkt, sondern auch weitreichende strukturelle Konsequenzen nach sich zieht – etwa einen drastischen Vertrauensverlust in zentrale gesellschaftliche Institutionen wie Polizei, Justiz oder Schule. Diese Ergebnisse leiten zu einer zentralen Frage über: Wie kann Kinder- und Jugendpsychotherapie derartigen Erfahrungen angemessen begegnen? Und welche konzeptionellen Ansätze sind erforderlich, um Diskriminierungserfahrungen systematisch in psychotherapeutische Versorgungskonzepte zu integrieren – als Grundlage für eine gerechte, wirksame und diskriminierungssensible psychotherapeutische Praxis?
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Keynote Speaker - Samstag, 21.03.2026, 9.45 - 10.30 Uhr
Aufwachsen in Wartezimmern der Ungewissheit – Kindheit in kollektiver Asylunterbringung
Was bedeutet es für Kinder, in kollektiven Asylunterkünften aufzuwachsen? Die ethnographische Studie Warten auf Transfer gibt Einblicke in den Lebensalltag von 44 begleiteten minderjährigen Asylsuchenden, die über ein Jahr in einer Schweizer Kollektivunterkunft teilnehmend beobachtend begleitet wurden. Die Ergebnisse zeigen: Für Kinder ist das „Camp“ ein Ort der Enge, Unruhe, Unsicherheit – und des Wartens. Sie erleben Lärm, Angst vor Gewalt, Ekel, Langeweile und Brüche in Freundschaften und Bildungswegen. Viele übernehmen Verantwortung für ihre psychisch belasteten Eltern, obwohl sie selbst kaum Schutz und Rückzugsräume erfahren. Die Unterbringung erschwert soziale Teilhabe, psychische Stabilität und ihre gesunde Entwicklung. Trotz allem äussern sie klare Vorstellungen von dem Leben «danach», dem «Ankommen, draussen in der Schweiz», geprägt von «Normalität», einer «privaten Wohnung», Ruhe und Sicherheit. Die Studie legt nahe, dass das Asylsystem zentrale kindliche Grundbedürfnisse verfehlt. Im Vortrag wird aufgezeigt, warum kollektive Unterkünfte für Kinder keine kindgerechten Orte sind, warum Transfers als Brüche erlebt werden können und welche strukturellen Veränderungen notwendig sind, um Kinderrechte im Asylbereich umzusetzen. Dabei wird insbesondere auf Empfehlungen zur Gestaltung von Standards für Schutz, Versorgung, Partizipation und Übergangsgestaltung eingegangen.

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Keynote Speaker - Freitag, 20.03.2026, 16.30 - 17.15 Uhr
„Vielleicht sind Sie da ja zu empfindlich“ – Mikroaggressionen als Manifestation struktureller Diskriminierung in der Psychotherapie
Unter dem Sammelbegriff der Mikroaggressionen sind alltägliche, subtile Diskriminierungserfahrungen in den vergangenen 20 Jahren verstärkt in den Fokus psychologischer Forschung gerückt. Das hat zur Entwicklung empirisch fundierter Taxonomien geführt, mit denen die Diskriminierungsrealität minorisierter Personen umfassender abgebildet werden kann. Dabei handelt es sich keineswegs um harmlose Phänomene. Mikroaggressionen verlangen Betroffenen nennenswerte Bewältigungsanstrengung ab und hängen (mutmaßlich kausal) mit Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit zusammen. Obwohl dies dafürspricht, Mikroaggressionen in der Psychotherapie aktiv zu berücksichtigen, finden sich gegenteilige Hinweise. Tatsächlich scheinen Psychotherapien selbst keine diskriminierungsfreien Räume zu sein: Das Ausmaß und konkrete Erscheinungsformen von Mikroaggressionen durch Therapeut:innen (sog. cultural ruptures), sowie deren Umgang damit deuten auf dringenden Handlungsbedarf hin. Welche konkreten Eigenschaften Therapeut:innen oder Dyaden mitbringen müssen um ein erfolgreiches Management von Mikroaggressionen zu gewährleisten, ist bislang vor allem Gegenstand theoretischer Überlegungen. Deren empirische Überprüfung könnte die Entwicklung geeigneter Trainings- und Sensibilisierungsmaßnahmen vorbereiten und damit eine immense Herausforderung an unser Fach adressieren – das Ermöglichen einer gerechten Versorgung innerhalb eines ungerechten Gesellschaftssystems.

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Keynote Speaker - Samstag, 21.03.2026, 16.00 - 16.45 Uhr
Trauma in women – neurobiological, and psychological perspectives
Women are estimated to bear twice the burden of posttraumatic stress disorder (PTSD) relative to men. Although this sex-based disparity has received consistent attention over the past several decades, several frameworks have highlighted that our field lacks empirical data on sex-specific contributors to PTSD risk. I will highlight several important known contributors at the levels of society, the environment, and psychological features, and then take a deep dive into new data showing sex-specific contributions of cyclical hormonal fluctuations, pregnancy, and perimenopause. I will provide examples that illustrate how fluctuations in ovarian hormones over the female lifespan contribute to patterns of brain function that increase PTSD risk, particularly in the domains of threat-related emotional responses and learning. These insights point to a multifactorial model of PTSD risk in women, shaped by intersecting social, psychological, and biological influences. The findings call for greater support for women’s mental health, and opportunities for PTSD risk assessment and intervention in the context of reproductive healthcare.

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Keynote Speaker - Freitag, 20.03.2026, 17.15 - 18.00 Uhr
Psychische Gesundheit von LGBTQIA+ Personen
„Queer zu sein ist heute doch ganz normal!“ – Trotz gestiegener gesellschaftlicher Akzeptanz sind Menschen, die sich als lesbisch, schwul, bisexuell, trans*, inter*, asexuell oder auf andere Weise queer identifizieren (LGBTQIA+), weiterhin überproportional von psychischer Belastung betroffen. Meta-Analysen zeigen, dass sie im Alltag deutlich häufiger Ängste, depressive Symptome sowie akuten Stress erleben als die Allgemeinbevölkerung. Auch traumatische Ereignisse im Sinne gängiger Klassifikationsmanuale und Traumafolgestörungen treten bei LGBTQIA+ Personen signifikant häufiger auf. Die genauen Ursachen dieser Ungleichheiten in der psychischen Gesundheit sind noch nicht vollständig geklärt. Etablierte Theoriemodelle verweisen jedoch auf den zentralen Einfluss sozialer und gesellschaftlicher Bedingungen: Wiederkehrende Diskriminierung und strukturelle Stigmatisierung gehen buchstäblich „unter die Haut“. LGBTQIA+ Personen stellen daher eine wichtige Zielgruppe für die Klinische Psychologie und Traumatologie dar. Ihre Lebensrealitäten bringen spezifische Einflussfaktoren mit sich, die sich auf die psychische Gesundheit auswirken und in der Versorgung berücksichtigt werden sollten. Gleichzeitig zeigen Übersichtsarbeiten: LGBTQIA+ Personen schätzen das Wissen von Fachkräften in der Gesundheitsversorgung zu queeren Themen als gering ein und wünschen sich hier Verbesserungen. Auch in der klinischen Forschung wurden die Ressourcen und Risiken von LGBTQIA+ Personen bislang wenig berücksichtigt, insbesondere im deutschsprachigen Raum. Diese Keynote gibt daher einen Überblick über zentrale Erkenntnisse und Modelle zur psychischen Gesundheit von LGBTQIA+ Personen sowie über praktische Implikationen für eine queersensible Versorgung.

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Personen, die interpersonelle Traumatisierungen erlebt haben, leiden oft nicht nur unter Symptomen der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), sondern auch unter weiteren Beeinträchtigungen, etwa einer eingeschränkten Affektregulation, Schwierigkeiten in interpersonellen Beziehungen und einem negativen Selbstbild. Gerade diese zusätzlichen Symptombereiche, die inzwischen als typische Beschwerden im Rahmen einer „Komplexen PTBS“ interpretiert werden, tragen maßgeblich zu den Alltagseinschränkungen Betroffener bei.
Bei „STAIR/Narrative Therapie“ handelt es sich um einen Behandlungsansatz, der genau diese Bereiche systematisch berücksichtigt und zusätzlich zur Reduktion der PTBS-Symptomatik eine flexible Behandlung von Problemen im Bereich der Emotionsregulation, der interpersonellen Kompetenzen und des Selbstbilds bei traumatisierten Personen erlaubt. Das Therapieprogramm integriert auf diese Weise in einem phasenorientierten Vorgehen wirksame Interventionen zur Behandlung komplexer Traumafolgestörungen.
Im Workshop wird ein Überblick über das Therapieprogramm gegeben sowie auf seinen Einsatz im Einzel- wie im Gruppensetting eingegangen. Neben der theoretischen Einführung wird es eine Reihe von praktischen Übungen geben.
Die Dialektisch-Behaviorale Therapie der Posttraumatischen Belastungsstörung (DBT-PTBS) ist eine modulare Psychotherapie zur Behandlung der komplexen PTBS. Zentrale Therapieziele sind a) die Verbesserung der Emotionsregulation, b) die Reduktion von sekundären traumaassoziierten Emotionen wie Schuld und Scham, c) die Reduktion der Belastung durch primäre traumassoziierte Emotionen, d) die Verbesserung von Selbst- und Körperbild sowie e) die Stärkung der Akzeptanz der traumatischen Ereignisse und der Aufbau eines sinnerfüllten Lebens. Zur Erreichung dieser Behandlungsziele werden Emotionsregulationsstrategien vermittelt, traumafokussierende kognitive und expositionsbasierte sowie akzeptanzbasierte Interventionen durchgeführt. Dabei orientiert sich die DBT-PTBS an einen in Therapiephasen zeitlich organisierten Therapieablauf unter zusätzlicher Berücksichtigung einer dynamischen Behandlungshierarchie wie sie auch die Standard-DBT vorgibt. In jeder Therapiephase stehen verschiedene Behandlungsmodule zur Verfügung, die nach Wenn-Dann-Algorithmen ausgewählt werden. Zwei unkontrollierte und zwei randomisiert-kontrollierte Studien konnten eine hohe Akzeptanz, Sicherheit und Effektivität der DBT-PTBS belegen.
Im Workshop werden die Prinzipien und die Behandlungsphasen der DBT-PTBS im Überblick dargestellt.
Häufig ist festzustellen, dass klinische Gutachter:innen in der Kausalitätsbeurteilung psychisch reaktiver Traumafolgen oft zu extrem gegensätzlichen Ergebnissen gelangen. Neben symptombedingter Behinderung der Exploration und besonderen Beziehungsaspekten, die die Objektivität der gutachterlichen Beurteilung beeinträchtigen können, sind es eine Vielzahl möglicher komorbider Störungen, die psychisch reaktive Traumafolgen überlagern und so zu Fehlbeurteilungen bei der Begutachtung führen können. Eine schädigungsunabhängige psychische Vorerkrankung macht die Beurteilung vollends schwierig
Aus diesem Grund hat die DeGPT ein zertifiziertes Fortbildungscurriculum verabschiedet, welches psychologische und ärztliche Fachkolleg:innen in die Lage versetzen soll, klinische Gutachten zu psychisch reaktiven Traumafolgen und ihrer Genese in sozialrechtlichen Verfahren fachkompetent zu erstellen. Die von der DeGPT entwickelten Standards für die schriftliche Gutachtenerstellung sollen dabei eine ausreichend begründete und für Dritte nachvollziehbare Beurteilung garantieren, die in der Praxis nicht immer gegeben ist.
In diesem Workshop sollen die speziellen Probleme anhand von Fallbeispielen (gerne auch mitgebrachte Fälle von Teilnehmer:innen) illustriert, die Standards der DeGPT zur Gutachtenerstellung der DeGPT erläutert und auf Besonderheiten bei der gutachterlichen Exploration und Beurteilung hingewiesen werden.
http://www.degpt.de/curricula/degpt-curriculum-begutachtung.html
Die interdisziplinär zusammengesetzte DeGPT-AG Trauma und Justiz geht in ihrem Workshop auf der diesjährigen Preconference vertieft auf den Umgang mit traumatisierten Personen im Kontext strafrechtlicher Verfahren ein. Vor der finalen Veröffentlichung der soweit fertiggestellten Handreichungen sollen die entsprechenden Themen im Workshop unter Einbezug der Praxiserfahrungen der Teilnehmenden diskutiert und weiter geschärft werden. Die vorgestellten Themen reichen von den Grundzügen der Aussagepsychologie und deren Relevanz für therapeutisches Handeln über realistische Erwartungsklärung bei Anzeigeabsicht bis hin zu dokumentationsbezogenen und rechtlichen Fragen im Vorfeld einer Aussage. Weitere Schwerpunkte bilden die Rolle der Therapeutinnen als sachverständige Zeuginnen vor Gericht, typische Abläufe von Strafverfahren sowie Herausforderungen rund um Retraumatisierungsrisiken. Ziel des Workshops ist ein offener Austausch über Hürden, Widersprüche und gelingende Praktiken an der Schnittstelle von Therapie, Aussage und Justiz. Neben der Vorstellung der Handreichungen wird dem allgemeinen Austausch über strukturelle und inhaltliche Stolpersteine und Chancen an der Schnittstelle Trauma und Justiz Raum gegeben.
Es ist davon auszugehen, dass mindestens 5-10 % der knapp 122 Millionen Menschen (UNHCR 2025), die weltweit auf der Flucht sind, lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* oder queere (LSBTIQ) Personen sind. Sie kommen aus Ländern, in denen ihnen die Meinungsfreiheit abgesprochen wird, sie kriminalisiert oder strafrechtlich verfolgt werden. Sie sind privater und staatlicher Gewalt ausgesetzt, werden gesellschaftlich ausgegrenzt.
LSBTIQ Menschen erleben auf der Flucht und bei ihrer Ankunft in Deutschland häufig ähnliche, potentiell traumatische Bedrohungen und Gewalt. Sie sind intersektional von Diskriminierung betroffen und damit hohen psychischen und chronischen Belastungen ausgesetzt. Ein niedrigschwelliger Zugang zum Hilfesystem, insbesondere zu psychosozialer Beratung und Psychotherapie spielt für LSBTIQ Geflüchtete eine besonders wichtige Rolle und stellt gleichzeitig eine oft unüberwindbare Herausforderung dar.
In dem Workshop wollen wir auf die besondere Situation von geflüchteten LSBTIQ eingehen und ein Raum zu Diskussion und Austausch öffnen: Wie können die Lebensrealitäten queerer Schutzsuchender intersektional begriffen und in Beratung und Psychotherapie adäquat begleitet werden? Wie können Klient:innen in ihrer Selbstbestimmtheit und Ressourcen gesehen und Zugänge zum Hilfe- und Gesundheitssystem hergestellt werden? Neben der Vermittlung von theoretischen Inhalten wollen wir aus der Praxis berichten, Übungen zur Selbstreflektion durchführen und uns mit der affirmativen Haltung von Berater:innen und Psychotherapeut:innen in der Arbeit auseinandersetzen.
Rassismus ist ein belastender Faktor, der zur Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Symptome beitragen kann – wird in der Praxis jedoch häufig nicht ausreichend als solcher erkannt oder benannt. Der Workshop bietet Raum für die Auseinandersetzung mit Rassismus als ätiologischem Faktor und lädt dazu ein, diese Perspektive professionell und sprachlich fassbar zu machen – zwischen therapeutischer Haltung und den Anforderungen in der psychotherapeutischen Regelversorgung. Nach einem kurzen Input zur Wirkung von Rassismus auf psychische Gesundheit folgt eine vertiefende Fallarbeit in Kleingruppen: In Teil 1 steht die Frage im Fokus, wie Rassismus in der individuellen Krankheitsentwicklung wirksam geworden sein könnte – und wie dies in eine rassismussensible Fallkonzeption einfließen kann. So soll geübt werden, rassismusbedingte Belastung nicht nur als Kontext, sondern als relevanten ätiologischen Faktor zu verstehen und sprachlich präzise zu erfassen. In Teil 2 wird erarbeitet, wie sich psychische Belastungen im Zusammenhang mit Rassismus in der Therapieplanung, Zielsetzung und Beziehungsgestaltung abbilden lässt – einschließlich der Reflexion eigener Anteile. Im Mittelpunkt steht die Annäherung an eine therapeutische Haltung, die sich mit diesen komplexen Erfahrungen auseinandersetzt.
Zum Abschluss folgt eine gemeinsame Zusammenführung zentraler Gedanken. Ich teile meine Perspektive als suchende Praxis und mit dem Wunsch nach kollegialem Weiterdenken und offener Auseinandersetzung mit strukturellen Herausforderungen.
Rassismus-induziertes Trauma umschreibt schwerwiegende Belastungsreaktionen, die durch kontinuierliche Ausgrenzungs- und Abwertungserfahrungen, aber auch direkte bzw. (kollektiv) vermittelte rassistische Gewalterfahrungen entstehen. Rassismus als Diskriminierungsform auf struktureller, institutioneller und interpersoneller Ebene ist kontinuierlich wirksam und hat erhebliche unmittelbare sowie transgenerationale Auswirkungen. Bekannt sind Folgen für rassifizierte Körper, für das Selbst- und Weltbild von Individuen und Communities, für die Beziehungs- und Lebensqualität sowie für die psychische Gesundheit und Leistungsfähigkeit bis hin zur Lebenserwartung.
In diesem Workshop möchten wir Wissen zu Lebensrealitäten und potenziellen Ursachen für Rassismus induziertes Trauma zur Verfügung stellen, die aus weiß positionierter Perspektive bislang oftmals unerkannt bleiben bzw. auf Empathielücken treffen. Mit Hilfe von Beispielen aus der Praxis sollen Rassismuserfahrungen sowie unsere verfahrensübergreifenden Handlungsansätze nachvollziehbar gemacht werden. Grundlage für die machtsensible Analyse struktureller Gewalt ist, die eigene soziokulturelle Positioniertheit hinsichtlich Rassismus und intersektierender Diskriminierungsformen reflektieren und einordnen zu können, um eigene Wahrnehmungs- und Handlungsmuster zu erkennen und eine belastbare therapeutische Haltung und Arbeitsweise zu entwickeln.
Ziele: Teilnehmende sollen ein vertieftes Verständnis von Rassismus bzw. Rassismus induziertem Trauma entwickeln, die eigene Positioniertheit, einhergehende Ressourcen und Herausforderungen kritisch einschätzen und nutzen lernen, sowie die eigene Arbeitsweise nachhaltig rassismuskritisch reflektieren und anpassen lernen. Eine aktive Teilnahme an Selbsterfahrungsübungen sowie das Einbringen eigener klinischer Erfahrungen trägt bei und wird erbeten.
Vor allem nach sexueller Gewalt und anderen potenziell traumatisierenden Erfahrungen mit Sexualität fällt es Betroffenen oft schwer, sich in intimen Begegnungen sicher und wohl zu fühlen. Doch auch körperliche und emotionale Gewalt, Vernachlässigung, traumatisch erlebte Geburten oder medizinische Eingriffe können Spuren hinterlassen.
Sind Betroffene in der Sexualität getriggert, drängen sich Erinnerungen an das Trauma ins Bewusstsein. Viele vermeiden deshalb Sexualität oder halten überforderndes Wiedererleben aus, dissoziieren oder haben Schmerzen. Andere leben (Online-)Sexualität impulsiv, unkontrolliert und suchtartig.
Weil sie Bedürfnisse und Grenzen nicht gut wahrnehmen können, fällt es vielen Betroffenen zudem schwer, intime Begegnungen einvernehmlich zu gestalten und zu erkennen, wann es gefährlich wird. Damit wächst nicht nur ihr Risiko für Retraumatisierung oder Reviktimisierung in Partnerschaften oder beim Dating, sondern auch für körperliche Verletzungen, ungewollte Schwangerschaften, sexuell übertragbare Infektionen und Grenzverletzungen gegenüber anderen.
Auch langfristig kann es zu vielfältigen Auswirkungen kommen: etwa zu Spannungen in Beziehungen, zu Trennungen, Partnerlosigkeit und unerfüllten Wünsche nach Elternschaft und Familie, aber auch zu psychischen Krisen und körperlichen Beschwerden.
Der Kurs eröffnet einen kompakten Einstieg in die Thematik. Sie erfahren …
Leider gibt es auch heute noch keine verfügbare Versorgung für traumatisierte Menschen mit SIE (Störung der intellektuellen Entwicklung / ICD 11), wie auch für Menschen mit Autismusspektrumstörungen (ASS) und/ oder Menschen mit schweren chronischen psychischen Erkrankungen, wie chron. Psychosen. Obwohl bei vielen dieser Klienten Traumafolgestörungen (auch komplexe) vorliegen und die Symptome teils ursächlich für die herausfordernden Verhaltensweisen sind, wurden Traumatisierungen in der Vorgeschichte in der Regel nicht abgeklärt, entsprechend nicht diagnostiziert und passende Hilfsangebote nicht angeboten.
Ausbildungsangebote gehen selten auf diese Personengruppen ein, weshalb sowohl stationäre, als auch ambulante Trauma-Therapieangebote diese Personengruppen häufig nicht behandeln. Unsicherheiten, fehlendes Wissen und Erfahrung behindern eine Verbesserung dieser Situation.
Grundsätzlich unterscheidet sich der Bedarf und die Begleitung nicht von der «üblichen» Traumabegleitung und -therapie. Manches benötigt mehr Zeit, einfachere Sprache / Worte, Hilfsmittel und Materialien teils aus dem Kinder- und Jugendbereich, aber diese notwendigen Anpassungen sind nicht so aufwendig und schwierig, wenn grundsätzlich die Bereitschaft besteht, mit diesen Menschen in Not zu arbeiten.
In diesem Workshop wird anhand von Praxisbeispielen vorgestellt, hinter welchen Symptombildern sich Traumafolgestörungen verstecken können. Material, das sich in der Praxis bewährt hat, Diagnoseinstrumente in Leichter Sprache und die Empfehlungen der neuen S3 Leitlinie PTBS für diese Klientel werden präsentiert. Ergänzend wird auch eine indirekte Diagnosemöglichkeit anhand eines psychologisch-pädagogischen Instrumentes, das auf Beobachtung durch das Umfeld basiert, vorgestellt, das zur Diagnostik schwerer beeinträchtigter Menschen genutzt werden kann, die nicht sprechen können.
Mit der Einführung der ICD-11 wurde ein bedeutender Paradigmenwechsel vollzogen: Das Erleben von Geschlechtsinkongruenz bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen wird nicht länger als psychische Störung klassifiziert, sondern unter der neuen Kategorie „Zustände im Zusammenhang mit sexueller Gesundheit“ („conditions related to sexual health“) geführt. Diese Entpathologisierung markiert einen zentralen Fortschritt in der medizinischen und psychotherapeutischen Bewertung geschlechtlicher Vielfalt.
Mit der Veröffentlichung der S2k-Leitlinie „Geschlechtsinkongruenz und Geschlechtsdysphorie bei Kindern und Jugendlichen“ im März 2025 liegt nun erstmals ein interdisziplinär abgestimmter Versorgungsstandard für Fachkräfte aus Psychotherapie, Medizin und Beratung vor. Die Leitlinie betont die Notwendigkeit einer entpathologisierenden, diskriminierungssensiblen Haltung und die Bedeutung individualisierter, affirmativer Unterstützungsangebote. Sie orientiert sich an internationalen Empfehlungen, u.a. der American Psychological Association sowie der European Association for Transgender Health (EPATH/WPATH).
Im Workshop wird nach einer zusammenfassenden Darstellung der S2k-Leitlinie der Schwerpunkt auf affirmativen Versorgungsansätzen im psychologischen und psychotherapeutischen Setting liegen. Praxisnah werden sowohl die Transitionsbegleitung im Jugendalter als auch die Anpassung der traumafokussierten CBT für LGBTQI+ Kinder und Jugendliche und deren Bezugspersonen vorgestellt.
Ingo Schäfer, Heide Glaesmer
In frühen Phasen ihrer wissenschaftlichen Karriere ist es für angehende Forscher:innen besonders wichtig, Routine im Schreiben von wissenschaftlichen Artikeln zu entwickeln. Auch das Knüpfen von Kontakten und der Austausch mit Kolleg:innen spielt eine wichtige Rolle. In diesem von der Zeitschrift „Trauma und Gewalt“ ausgerichteten Workshop haben Nachwuchswissenschaftler:innen die Gelegenheit an einem konkreten Manuskript mitzuwirken, das später in „Trauma und Gewalt“ publiziert werden soll sowie Kontakte zu knüpfen und zu erweitern und eine Basis für weitere Kooperationen zu legen. Im Workshop soll unter Betreuung der beiden Leiter:innen ein Manuskript vorbereitet und geschrieben werden. Der Schreibprozess wird über den Workshop hinaus begleitet. Zielgruppe sind Kolleg:innen, die sich in frühen Phasen ihrer Karriere befinden (z.B. Masterand:innen und Doktorand:innen). Von den Teilnehmenden wird Folgendes erwartet:
1.) Teilnahme am Vorbereitungstreffen (online)
2.) Vollständige Anwesenheit am Workshop
3.) Teilnahme an zwei Videokonferenzen in den folgenden Monaten
4.) Erledigung von spezifischen Aufgaben nach jeder der drei Konferenzen
5.) Beteiligung an der Finalisierung des entstehenden Manuskripts

Wir laden Sie herzlich zur Hafenrundfahrt am 14.03.2025 von 18.30-19:30/20.00 Uhr von der Fa. Barkassen-Centrale Ehlers GmbH ein!
Ankunft: 19:30 Uhr Anleger Messberg (das ist ganz in der Nähe des Tagungsfestes!)
Die Teilnehmer:innenzahl ist begrenzt. Melden Sie sich hier an: kongress@isd-hamburg.de
Wir laden Sie herzlich zu einer Hausführung durch die Elbphilharmonie am 14.03.2025 ein.
Die Tour durch das neue Konzerthaus mitten in der Elbe führt durch den Kaispeicher, über die Plaza, durch die Foyer Bereiche bis zum Herzstück der Elbphilharmonie ‒ den Großen Konzertsaal. Neben spannenden Geschichten zur Entstehung der Elbphilharmonie und Details zur Architektur des neuen Hamburger Wahrzeichens werden hier auch interessante Informationen zum Konzerthausbetrieb und dem Musikprogramm der Elbphilharmonie vermittelt.